Fünftes Sankelmarker Gespräch zur Lehrerbildung 2017
Vor welchen technischen, lernpsychologischen und didaktischen Herausforderungen Schulen und die Lehrerbildung durch die Digitalisierung der Welt stehen, diskutierten vom 10. bis 11. November 2017 rund 50 Expertinnen und Experten beim „Fünften Sankelmarker Gespräch zur Lehrerbildung“ an der Europa-Universität in Flensburg.
Die Sankelmarker Gespräche zur Lehrerbildung sollen einen Raum schaffen, um grundlegende Probleme der Lehrerbildung und des Lehrerberufes – möglichst jenseits von tagespolitischen Fragestellungen - unter Experten differenziert und vertieft diskutiert werden können. Mit diesem Anliegen ist der Wunsch verbunden, dass sich daraus Handlungsperspektiven auch für Entscheidungsträger ableiten lassen. Das widerspiegelt sich in der Zusammensetzung der Teilnehmenden an den Gesprächen. Es sind Expertinnen und Experten aus den Bereichen „Schule“, „Lehrerbildung“ (Universitäten und Studienseminare) und „Bildungsverwaltung“ (Ministerien, KMK, Akkreditierungsrat) sowie Vertreterinnen und Vertreter regionaler und überregionaler Medien.
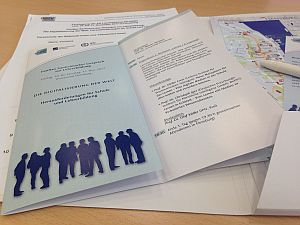
Das diesjährige Treffen stand unter dem Thema „Die Digitalisierung der Welt – Herausforderungen für die Schule und Lehrerbildung“.
Klaus Karpen, ehemals Abteilungsleiter und Vertreter des Staatssekretärs im Bildungsministerium Schleswig Holstein und Vorsitzender des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz sowie heute einer der Organisatoren der Sankelmarker Gespräche, eröffnete die Tagung.
Danach sprachen der Gastgeber und Hausherr, der Präsident der Europauniversität Flensburg, Prof. Dr. Werner Reinhardt, Prof. Dr. Olaf Köller, Direktor des IPN und Vertreter der Mitorganisatoren der Sankelmarker Gespräche und Dr. Dorit Stenke, Staatssekretärin der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig Holstein die Grußworte zu Beginn der Tagung (Bild im Teaser, Foto: DLR PT)
Anders als vielfach üblich wird bei den Sankelmarker Gesprächen durchweg im Plenum referiert und diskutiert. So haben alle Teilnehmenden denselben Informationsstand, um intensiv zu diskutieren und dabei ihre Position neu zu justieren oder bestätigen zu können.
Das Tagungsprogramm begann mit zwei Berichten aus der Schulpraxis, die den Nutzen der Digitalisierung in der Schule für die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte sehr deutlich zum Ausdruck brachten. Spannend war dabei der Blick über die Landesgrenze nach Dänemark.
Maike Schubert, Schulleiterin der vielfach ausgezeichneten Freiherr-vom-Stein-Schule in Neumünster berichtete über die Prozesse der Einführung und komplexen Nutzung der Digitalisierung und über die positiven Wirkungen, auch die sozialen Veränderungen im Schulalltag.
Allan Kjaer Andersen, Schulleiter am Oerestad Gymnasium in Kopenhagen zeigte in Wort und Film, was für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte mit der Digitalisierung in dieser Schule erreicht werden konnte.
Die Auseinandersetzung mit reflektierenden und forschenden Themen erfolgte in Frageblöcken.
Der Fragenblock 1 betrachtete unter dem Stichworten „Realität - Virtualität“ die folgenden Fragen:
- Wie verändern die elektronischen Medien die Weltwahrnehmung?
- Wie sind diese Veränderungen zu werten?
- Welche Produkte, Technologien, Konzepte spielen gegenwärtig für Schule und Unterricht eine Rolle?
- Welche Trends sind erkennbar?
- Worauf haben wir uns einzustellen?
Die Thesenbeiträge dazu hielten:
Prof. Dr. Thomas Knaus vom Centre for Educational Technology, Frankfurt/M., sprach zu: „Me, my Tablet and I – Herausforderungen des digitalen Zeitalters für Schule und universitäre Lehrendenbildung“ und Prof. Dr. Ira Diethelm von der Universität Oldenburg reflektierte zu „Digitalisierung und Schule: zwischen Buzzword-Bingo und Allgemeinbildungsauftrag“.
Mit den auch bewusst provokant gewählten Vortragstiteln und Ausführungen setzten sich beide kritisch mit dem gegenwärtigen Stand in Wissenschaft, Lehre und Praxis auseinander.
Der Fragenblock 2 unter dem Stichwort „Lernen / E-Learning“ beleuchtete das Thema unter dem Aspekt der praktischen Anwendung. Im Mittelpunkt standen die Schwerpunkte:
- Lernpsychologischer Aspekt: Wie verändert sich das Lernen, verändern sich Lernkultur, Wissensbildung und Wissensnutzung? und
- Didaktischer Aspekt: Wie lassen sich die elektronischen Medien für die Aufbereitung von Lern -Inhalten, die Gestaltung von Lernmaterialien, die Festlegung von Lernschritten und Sozialformen nutzen?
Die praxisbezogen Thesenbeiträge als Input für die Diskussion gaben Prof. Dr. Christoph Igel, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Berlin, zum Thema: „Lernen in Echtzeit - Vom Lernen mit Medien zu KI-basierten Wissensdiensten“ und Prof. Dr. Ulrike Cress vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen, zum Thema: „Neue Metaphern für das Lernen - Was digitale Medien in der Schule alles leisten und verändern können“.
Mit der kontroversen Diskussion zu den Vor- und Nachteilen künstlicher Intelligenz – insbesondere unter Bildungs- und humanistischen Aspekten – ging der erste Tagungstag zu Ende.
Der zweite Tag startete mit dem Fragenblock 3 zum Stichwort „Schule“. Die zentralen Fragen waren:
- Welche Veränderungen für Aufgabe / Funktion und Gestalt der Schule ergeben sich aus der Nutzung und dem Einsatz der elektronischen Medien?
- Wie soll Schule künftig ausgestattet sein?
- Wie verändert sich die Lehrerrolle?
Die Thesenbeiträge, die zur Diskussion anregen sollten kamen von Prof. Dr. Birgit. Eickelmann von der Universität Paderborn zum Thema: „Digitale Medien in der Schule – Thesen im Spannungsfeld zwischen Hype und Zukunftsfähigkeit“ und von Ralph Müller-Eiselt, Senior Expert bei der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh, der zu „Lösung statt Problem?! – Wie Schulen den digitalen Wandel nutzen können“ sprach.
Mit dem Fragenblock 4 zum Stichwort „Lehrerbildung“ endete die Tagung. Im Mittelpunkt des letzten Beitragsblocks standen die Fragen:
- Welche Konsequenzen für die inhaltliche Ausgestaltung und die Struktur der Lehrerbildung sind aus den Antworten zu den Frageblöcken 1 bis 3 zu ziehen?
- Welche Erfahrungen sind bereits gemacht worden?
- Unter dem Aspekt „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ wird die Frage: Welche Funktion können die elektronischen Medien in der Lehrerbildung übernehmen? aufgeworfen.
Die Thesenbeiträge hielten Prof. Dr. Christian Filk von der Europa-Universität Flensburg, unter der Überschrift: „Schule und Unterricht im digitalen Medienumbruch – Folgen und Konsequenzen für die drei Phasen der Lehrer/innenbildung“ und Dr. habil. Thomas Riecke-Baulecke, Direktor des IQSH, Kiel, zum Thema: „Auf dem Weg zur Lehrerbildung 4.0 oder verschlafen Bildungsadministrationen und Hochschulen die digitale Revolution?“
Die Gesprächsbeiträge der Tagungen von 2011, 2013 und 2015 sind als Heft 2 / 12, 2 / 14 bzw. 2/16 der „Zeitschrift für Bildungsverwaltung“ der DGBV veröffentlicht.